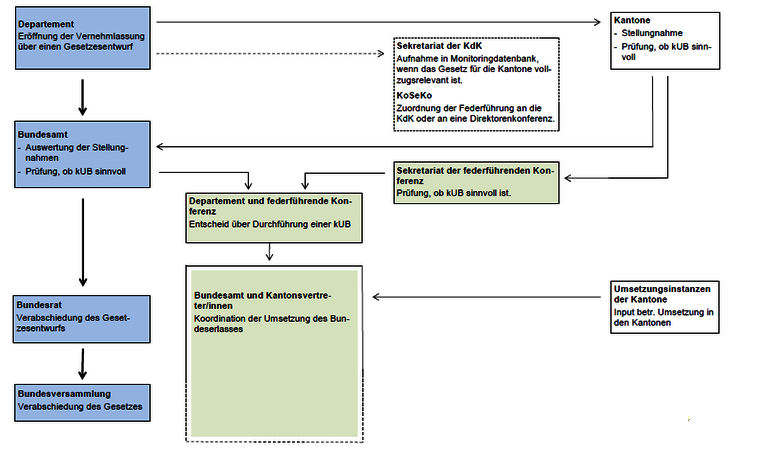Nationale Föderalismuskonferenzen
Nach dem Erfolg der Internationalen Föderalismuskonferenz von 2002 in St. Gallen werden in der Schweiz regelmässig nationale Konferenzen durchgeführt. Sie bieten Gelegenheit, unabhängig vom Alltagsgeschäft eine Zwischenbilanz zum Schweizer Föderalismus zu ziehen, um darauf aufbauend Perspektiven für die Zukunft zu entwickeln. Dabei sollen das Innovationspotenzial des Föderalismus ausgelotet, allfällige Innovationshemmnisse erkannt und die politische Willensbildung für Reformprozesse angestossen werden. Der regelmässige nationale Austausch dient zudem der Verbesserung des allgemeinen Verständnisses von Föderalismus und der Sensibilisierung für diese Thematik in Politik und Öffentlichkeit. Träger der Konferenzen sind neben den jeweiligen Gastgeberkantonen der Bundesrat, der Ständerat sowie die KdK.
Die letzte Nationale Föderalismuskonferenz fand am 13. und 14. November 2025 in Zug statt. Im Fokus stand die Frage «Zentralisierungsdruck – Welche Zukunft hat der Föderalismus?».
Sechs weitere Konferenzen haben bereits stattgefunden:
- 27./28. Mai 2021 in Basel (BS) zum Thema «Föderalismus und Dynamik»
- 26./27. Oktober 2017 in Montreux (VD) zum Thema «Wird die Schweiz in 50 Jahren immer noch föderalistisch sein?»
- 27./28. November 2014 in Solothurn (SO) zum Thema «Was trägt der Föderalismus zum Zusammenhalt und zur Solidarität bei?»
- 26./27. Mai 2011 in Mendrisio (TI) zum Thema «Föderalismus und neue territoriale Herausforderungen»
- 27./28. März 2008 in Baden (AG) zum Thema «Der Schweizer Föderalismus unter Effizienzdruck: Was sind die Perspektiven?»
- 15./16. September 2005 in Freiburg (FR) zum Thema «Der kooperative Föderalismus vor neuen Herausforderungen»
Dokumentation
Sprechnotiz von Regierungsrat Christian Rathgeb, Präsident KdK, vom 27. Mai 2021
Medienmitteilung und Programm der 6. Nationalen Föderalismuskonferenz in Basel
Sprechnotiz von Regierungsrat Benedikt Würth, Präsident KdK, vom 26. Oktober 2017
Medienmitteilung und Programm der 5. Nationalen Föderalismuskonferenz 2017 in Montreux
Sprechnotiz von Staatsrat Jean-Michel Cina, Präsident KdK, vom 27. November 2014
Medienmitteilung und Programm der 4. Nationalen Föderalismuskonferenz 2014 in Solothurn
Medienmitteillung und Programm der 3. Nationalen Föderalismuskonferenz 2011 in Mendrisio
Medienmitteilung vom 27. August 2007 zur 2. Nationalen Föderalismuskonferenz 2008 in Baden
Medienmitteilung vom 7. Mai 2004 zur 1. Nationalen Föderalismuskonferenz 2005 in Freiburg